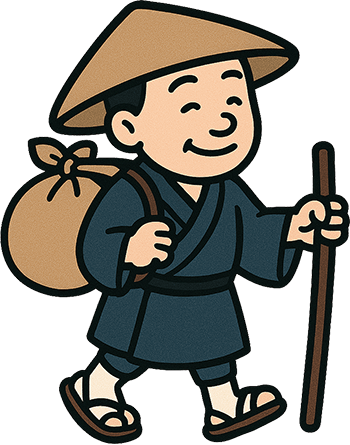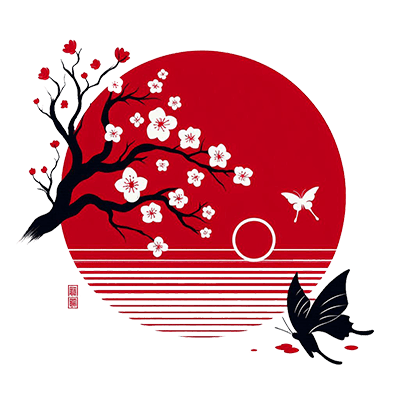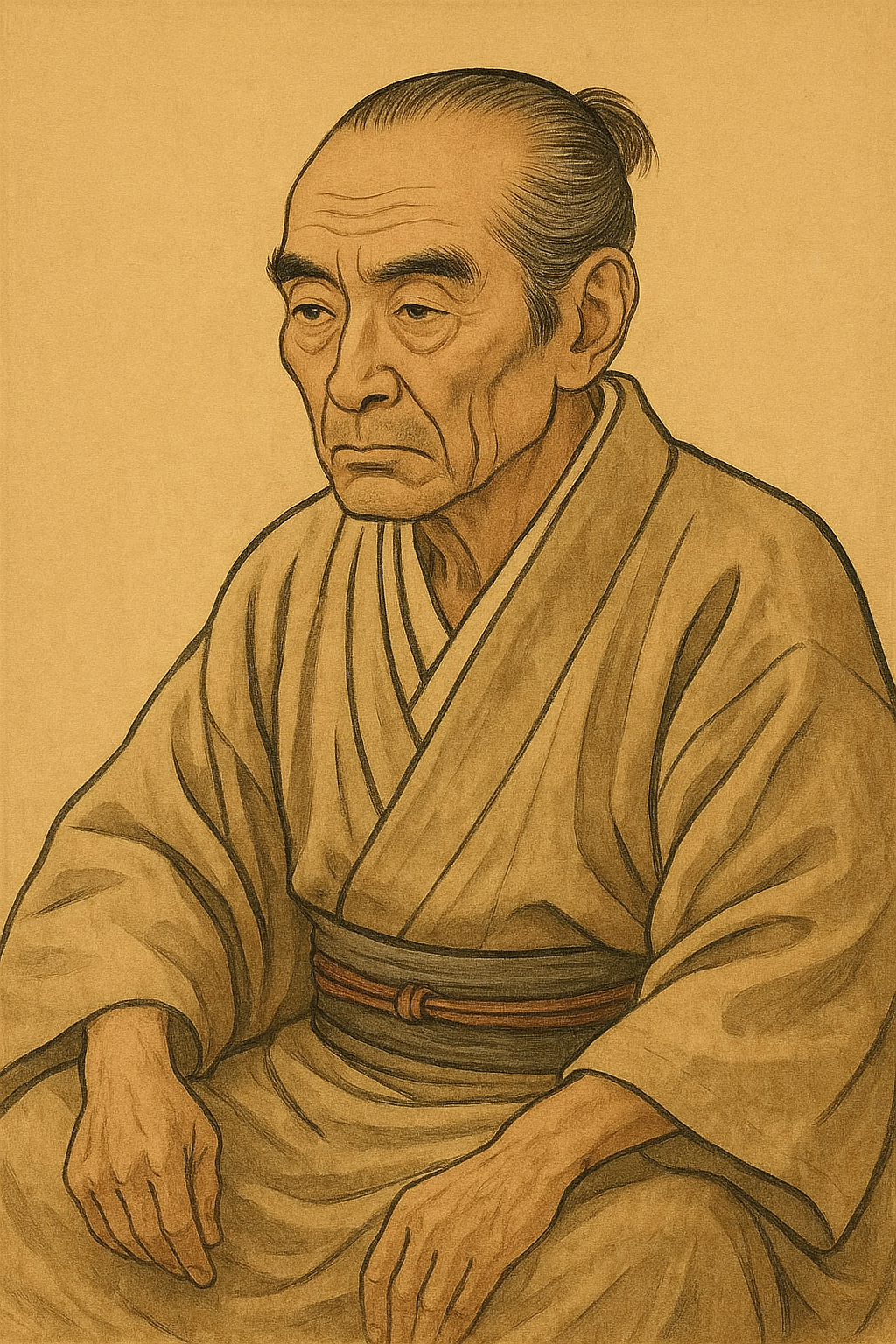
So könnte er ausgesehen haben … Bonchōs Züge sind nicht überliefert. Es gibt keine Portraits oder Zeichnungen des Dichters, auf denen sein Äußeres erkennbar wäre.
Matsuo Bashō ist heute der bekannteste Name der klassischen Haikudichtung. Doch um ihn herum entstand ein Kreis von Dichtern, die seine Ideen mittrugen, kommentierten – und zum Teil auf ihre Weise erweiterten. Einer der markantesten unter ihnen war Nozawa Bonchō. Kein folgsamer Schüler, sondern ein selbstbewusster Mitgestalter. Seine Dichtung steht für eine klare, unprätentiöse Form der Beobachtung, die auch heute noch überzeugt.
Bonchō neigte dazu, vermeintlich »poetische« Motive (Schnee, Mond, Berge) entzaubert darzustellen – manchmal humorvoll, manchmal streng sachlich.
上行くと下くる雲や秋の天 凡兆
ue yuku to / shita kuru kumo ya / aki no ten
Wolken steigen auf,
Wolken sinken ab –
Herbsthimmel.
Leben und Werdegang
Bonchō wurde vermutlich um 1640 in Kanazawa geboren, in der damaligen Provinz Kaga. Das genaue Geburtsjahr ist nicht gesichert. Auch über seinen bürgerlichen Namen herrscht Unklarheit; verschiedene Quellen nennen Chōjirō, Nozawa, Miyabe oder andere Varianten. Sicher ist: Er ließ sich später in Kyōto nieder, arbeitete dort als Arzt unter dem Namen Tatsuju, und begann in literarischen Zirkeln aktiv zu werden.
Sein frühes Haikai signierte er mit dem Namen Kasei (»aus Kaga stammend«). Ab etwa 1688 trat er in den Kreis von Matsuo Bashō ein, der damals Kyōto besuchte. Gemeinsam mit seiner Frau, die unter dem Namen Hakō dichtete, nahm er an den Versrunden (Haikai no renga) der Bashō-Schule teil. Zu dieser Zeit begann er, das Pseudonym Bonchō zu verwenden – geschrieben mit den Zeichen 凡兆, was etwa »gewöhnliches Zeichen« oder »ein schlichtes Omen« bedeutet.
市中はものの匂ひや夏の月 凡兆
Auf dem Marktplatz,
der Duft von allem –
Sommermond.
Als Bashō ihn 1691 zusammen mit Mukai Kyorai mit der Redaktion der berühmten Haikai-Sammlung Sarumino (Affenregenmantel) betraute, war das ein Zeichen großen Vertrauens. Bonchō war dabei nicht nur Mitherausgeber, sondern lieferte mit 41 der 93 Hokku (Eröffnungsverse) auch den umfangreichsten Beitrag der Anthologie. Kyorai, ein enger Vertrauter Bashōs, war für das Vorwort und die Kommentierung verantwortlich und unterstützte Bonchō redaktionell.
Die Haiku-Philosophie des Alltäglichen
Bonchōs dichterischer Stil war geprägt von einer besonderen Form der Zurückhaltung. Während viele Haikai-Dichter ihrer Zeit emotionale Stimmungen oder symbolische Motive bevorzugten, zeigte er eine Vorliebe für unmittelbare, ungeschminkte Szenen. Seine Verse wirken oft wie Momentaufnahmen – präzise, offen für Interpretation.
Statt poetischer Umschreibungen benennt er schlicht, was er sieht, ohne besondere symbolische Aufladung. Keine falsche Erhabenheit, sondern ein ehrlicher Blick, so wie Bashō es selbst forderte.
yo no naka wa / sekirei no o no / hima mo nashi
So ist die Welt …
wie der Schweif einer Bachstelze,
nicht für einen Atemzug still.
Ein Bachstelzen-Schwanz wippt unaufhörlich. Egal, wo der Vogel landet, egal was er tut. Warum ist nicht so ganz klar.
Was bei anderen Dichtern erklärungsbedürftig war, ließ Bonchō bewusst aus. Er vertraute auf das Bild selbst. Das, was sichtbar oder hörbar war, genügte. Diese Haltung erinnert an spätere Tendenzen der Haiku-Geschichte, etwa an den Shasei-Stil (»Skizze aus dem Leben«) von Masaoka Shiki, der Bonchō später ausdrücklich würdigte. Für Bonchō war das Gewöhnliche nicht banal – im Gegenteil. Er entdeckte im Alltäglichen die Poesie, ohne ihr ein Etikett aufzudrücken.
ゆふめしに かますご喰へば 風薫る
Zum Abendessen
Barrakudajunge –
der Wind duftet.
Konflikte und Einschnitte
Bonchō war eine eigenständige Persönlichkeit – auch innerhalb des Bashō-Kreises. Während viele Schüler dem Meister bedingungslos folgten, behielt er sich eine kritische Distanz. Überliefert sind Diskussionen über Versgestaltung, in denen er Bashō widersprach oder eigene Vorschläge hartnäckig verteidigte.
Gegen Ende von Bashōs Leben trübte sich das Verhältnis. Um 1693 kam es offenbar zu einem Vertrauensbruch: Bonchō soll in eine Intrige gegen einen Förderer Bashōs verwickelt gewesen sein. Kurz darauf wurde er wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an illegalem Handel verhaftet – vermutlich im Zusammenhang mit dem streng kontrollierten Überseehandel über Nagasaki. Die genauen Umstände liegen im Dunkel der Geschichte. Fest steht: Bonchō wurde inhaftiert und nach seiner Freilassung im Jahr 1701 aus Kyōto verbannt.
出るからは 花なき在も 花見かな
Wenn man schon draußen ist,
da wo keine Blüten sind …
Blütenschau!
Er ließ sich mit Hakō in Ōsaka nieder, wo beide in einfachsten Verhältnissen lebten, aber weiterhin mit alten Weggefährten korrespondierte. Anlässlich Bashōs Tod 1694 findet sich sein Name nicht in den Aufzeichnungen. Ob er das traurige Ereignis freiwillig oder im Knast sitzend versäumte, bleibt Spekulation.
Im Frühjahr 1714 starb Bonchō. Gepflegt von seiner Ehefrau wurde er 70 bis 75 Jahre alt.
Bedeutung und Nachwirkung
Bonchōs Nachruhm verblasste zunächst. Doch in der literarischen Moderne entdeckten Reformer wie Masaoka Shiki seine Verse neu. Sie sahen in seiner nüchternen, klaren Darstellungsweise ein wichtiges Gegengewicht zu überladenen symbolischen Haiku.
Heute gilt Bonchō als einer der eigenständigsten Köpfe der Bashō-Schule – kein Epigone, sondern ein Mitdenker. Seine Gedichte zeigen, dass poetische Kraft nicht aus Pathos oder persönlichem Ausdruck entstehen muss. Die Szene genügt. Der Leser sieht selbst.
Wer sich für die Vielfalt klassischer Haiku interessiert, sollte Bonchō nicht übersehen. Er gehört zu jenen, die das Genre in der Tiefe erweitert, nicht nur im Stil verfeinert haben.
たがために夜るも世話やくぼととぎす 野澤凡兆
Um wen bloß
kümmert er sich sogar nachts –
der Kuckuck?
Quellen
- Wikipedia (japanisch): 野沢凡兆
- Nippon.com: 凡兆のリアル – 俳諧に宿る「写生」の先駆
- Yamaguchi City Library – 文人の墓を歩く:凡兆
- Haiku-Lexikon (japanisch): Sarumino und Genroku-Haikai
Werkstattbericht
Die Grafiken wurden von DALL-E und dem Microsoft Designer via Bing generiert.