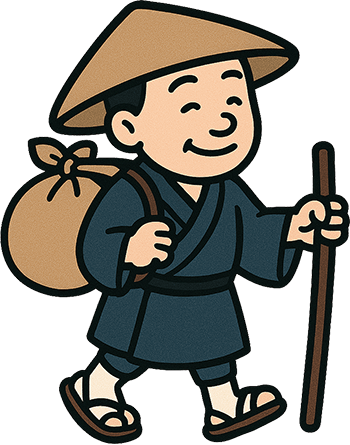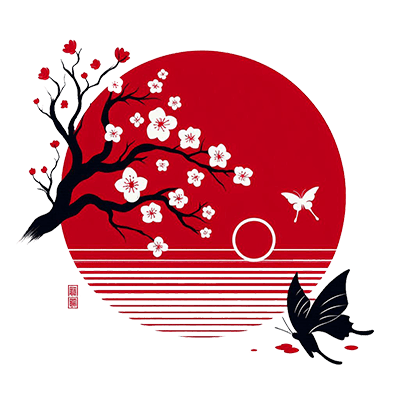So hätte sie aussehen können – die Frau, die eine rote Feder hielt. Einige Verse sind erhalten. Ihr Gesicht nicht. Doch dieser Ausdruck kommt ihr vielleicht nahe: wach, diszipliniert, aber nicht gebändigt.
Die rote Feder: Poesie einer unbeirrbaren Frau
In einer Zeit, in der das Dichten den Männern gehörte und die Regeln festgezurrt waren, schrieb sie sich mit roter Feder in die Literaturgeschichte: Hakō (羽紅) war eine der wenigen namentlich bekannten Dichterinnen der Edo-Zeit. Ihr Name – ein Bild aus »Feder« (羽) und »Karmesinrot« (紅) – war nicht nur ein Pseudonym. Er war Programm.
Heute wirkt er beinahe kühn. Man könnte an Leidenschaft oder Aufbegehren denken. Doch in ihrer Zeit war »rot« das Zeichen zarter Schönheit, von Empfindsamkeit, von Tiefe und Vergänglichkeit.
In die Irre geführt
Hakō (1660–1725)
vom Sternenlicht –
Winterregenschauer.
Eine Frau zwischen zwei Welten
Nozawa Tome, geboren vermutlich in den 1660er-Jahren in Kyōto, war die Ehefrau des Haiku-Dichters Nozawa Bonchō, einem Schüler des berühmten Matsuo Bashō. Gemeinsam bildeten sie ein literarisches Paar – in einer Dichtungskultur, die Frauen kaum Raum ließ, eine Seltenheit.
Wäre es mein Kind …
Hakō (1660–1725)
ich ließe es nicht mitgehen
in den nächtlichen Schnee.
Das wohl mutigste ihrer Haiku – sie verbot ihrem Mann, den 12-jährigen Diener mitzunehmen. Bonchō ging beschämt allein. So die Legende.
Hakō lebte in Kyōto im Stadtteil Ogawa. 1691 wurde sie buddhistische Nonne – ein äußerer Schritt, der ihr innerlich neue Freiheit brachte.
Ein Abend mit Bashō
Im Frühjahr 1691 besuchten Hakō und Bonchō ihren Lehrer Bashō im ländlichen Sagano bei Kyōto. Gemeinsam mit anderen Dichtern verbrachten sie die Nacht unter einem Moskitonetz – man plauderte, dichtete, lachte bis zum Morgen. Bashō hielt die Begegnung in seinem Saga Nikki fest:
Der Frühlingsregen
Hakō (1660–1725)
klart auf – an der Dachkante
zwitschern Spatzen.
Worte, die bleiben
Von Bashō sind über 230 Briefe erhalten – nur acht davon gingen an Frauen. Drei an Hakō. In einem dieser Briefe aus dem Jahr 1693 zitiert Bashō eine bemerkenswerte Selbsteinschätzung Hakōs:
»Weder eine Schönheit noch eine tugendhafte Frau – nur mein Herz.«
Der Brief richtet sich an »die Nonne von Ogawa«. Bashōs Ton ist persönlich, respektvoll und frei von Überhöhung – er zeigt eine Frau, die sich nicht über Äußerlichkeiten definiert, sondern über Mitgefühl und Haltung.
Ihre Haiku
In der berühmten Anthologie Sarumino war Hakō mit 13 Haiku vertreten – ein beachtlicher Anteil. In der späteren Anthologie Tamamoshū, herausgegeben von Yosa Buson mit einem Vorwort von Chiyo-ni, ist sie ebenfalls vertreten.
Von der Mondblume
Hakō (1660–1725)
gerufen werden –
diese drückende Hitze!
Hakōs Vers spielt mit dem Kontrast zwischen der verlockenden Schönheit der nächtlichen Blüte und der erdrückenden Sommerhitze – eine Meditation über Sehnsucht und die Widrigkeiten des Alltags.
Stürze, die sie überstand
Die Jahre nach 1693 wurden schwer. Bonchō geriet in einen Handelsskandal, wurde inhaftiert, verlor Ansehen und Einkünfte. Hakō blieb. Die beiden zogen sich nach Ōsaka zurück. Sie pflegte ihn bis zu seinem Tod im Frühjahr 1714.
Danach verliert sich ihre Spur. Einige Quellen vermuten ihr eigenes Ende um 1716, andere erwähnen sie noch 1722.
Was bleibt
Von Hakō ist wenig überliefert. Keine gesicherten Lebensdaten, kein Grab, kaum Texte. Aber ihr Name taucht auf – in Anthologien, in Briefen, in Nebensätzen. Das genügt, um zu wissen: Es gab sie.
Haarnadel und Kamm
Hakō (1660–1725)
haben ihre Zeit gehabt –
gefallene Kamelien.
Werkstattbericht
Quellen (japanisch): Saga Nikki (Kyoto Women’s University), NIJL Datenbank, Haikai no Sato, Shōmon Jūtetsuden (NDL), Bashō Shokan Zenshū (Iwanami)