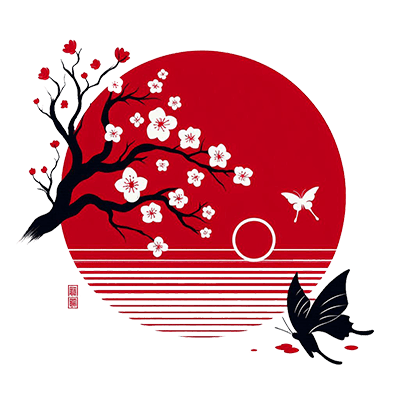Japaner hatten und haben ein feines Gehör für natürliche Geräusche – ob plätschernd, sickernd, ploppend, tropfend, murmelnd oder eben vollkommen still.
Früher konnte man Wasser überall hören. Man ging durch ein Feld und hörte es murmeln und sickern zwischen den Halmen. Heute läuft im Hintergrund Musik – immer, überall. Auch in Japan. Die Welt ist mit Tönen zugekleistert. Und wenn keine Musik gespielt wird, hat man die eigene dabei, Kopf- und Ohrhörer sind überall. Heute will man die Umwelt nicht mehr wahrnehmen, man separiert sich, schützt sich vor ihr, kapselt sich ab.
In der Edo-Zeit lauschten Dichter dem Wind, dem Tropfen eines Baches, dem ersten Ruf eines Vogels. Sie schrieben Gedichte und hatten ein feines Gespür für den Klang, der sie umgab. Ob man davon noch etwas hören kann?
In den Bergen –
Tagami Kikusha (1753–1826)
auf meinem Strohhut nur das
Geräusch der fallenden Blätter.
Frühlingswind –
Mokudō (1666–1723)
zwischen jungem Getreide
das Geräusch des Wassers.
In der Stille ist jedes Geräusch bedeutungsvoll: Ein leises Fließen. Ein Vogel, der nicht ruft. Der Ton des Wassers, nicht als Effekt, sondern als Zeichen für Zeit, Wandel, Gegenwart. Auch deutsche Dichter wie Eichendorff hatten dieses feine Gehör: Sie hörten Wälder rauschen, Bäche murmeln, Glocken klingen – ohne Tonspur im Hintergrund. Es ging nicht um Klangkulisse, sondern um eine Welt, die spricht, wenn man sie lässt.
Mokudō hat hier eindeutig bei Bashōs berühmtem Frosch-Haiku gelauscht. Die letzte Zeile ist im japanischen Original (Furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto) identisch:
Alter Teich —
Matsuo Bashō (1644–1694)
Ein Frosch springt hinein.
Geräusch des Wassers.
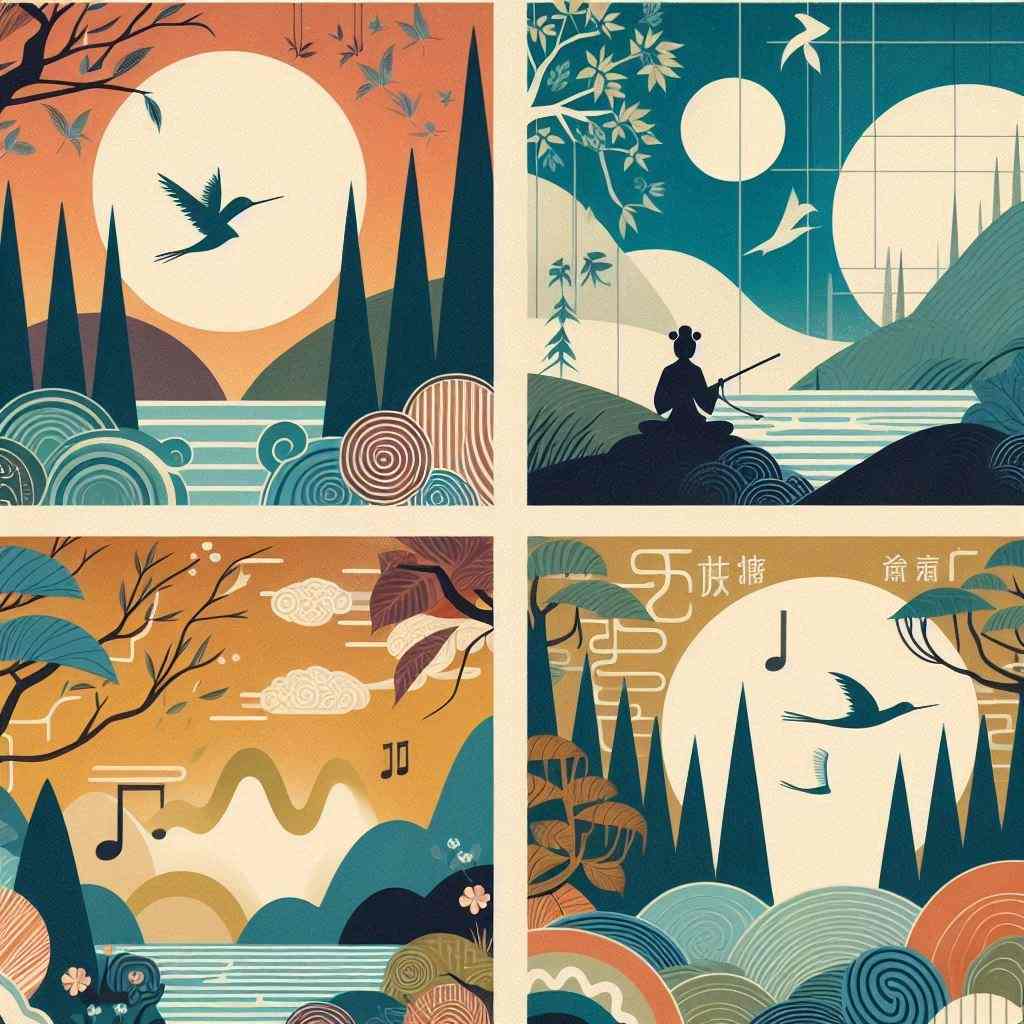
Mokudō übernimmt nicht nur den Klang, sondern auch die strukturierende Bewegung. Bei Bashō ist es ein plötzlicher Impuls → Klang → Leere. Bei Mokudō nur sanftes Wehen → Fließen → Klang.
Aber wo Bashōs mizu no oto fast wie ein Gong wirkt – eine Art Zen-Schlag –, ist Mokudōs Version eher ein kontinuierliches Fließen, wie ein feiner Gegentakt zum Sprung des Frosches. So gesehen: keine plumpe Kopie, sondern eine Hommage mit ganz eigenem Rhythmus. Man lauscht atemlos mit:
Stille!
Miura Chora (1729–1780)
Im Fallen berühren sich
die Blüten – ein Geräusch.
Heute aber ist selbst der Regen oft übertönt. Selbst Natur wird beschallt – im Café, im Zug, im Bad. In Japan sogar auf öffentlichen Toiletten. Nicht damit man mehr hört, sondern damit man nichts anderes mehr hören muss. Und genau hier setzen Haiku an: Sie fordern nicht auf, sie beschallen nicht – sie erinnern. Daran, dass man die Welt wieder hören kann, wenn man lernt, sie nicht sofort zu übertönen. Also: Einfach mal wieder hinhören.
Tropfen für Tropfen –
Masaoka Shiki (1867–1902)
das Geräusch des Regens
am Bambusvorhang.
Selbst der Klang
Taneda Santōka (1882–1940)
der Regentropfen
ist alt geworden.
Weiße Kamelien –
Takakuwa Rankō (1726–1798)
nur ihr Fallen ist zu hören,
mondhelle Nacht.
Huiiihuiii pfeift der Wind
Uejima Onitsura (1661–1738)
durch den leeren Himmel –
Winterpfingstrosen.
Auch das japanische Original lautmalt hier kräftig (hyuhyu to kaze wa sora yuku fuyu botan).
Frostmorgen –
Kobayashi Issa (1763–1828)
die Holzkohle knackt und knistert
in sprühender Laune!
Am Ende ist es so:
das endlose Geräusch
Taneda Santōka
des Wassers –
Buddha!

Es ist, wie es ist; und der Klang ist, was er immer war. Laut und leise. Such dir ein Haiku aus. Eines, das du behältst, mitnimmst – für den Moment, an dem es passt.
Werkstattbericht
Die Grafiken wurden von DALL-E und dem Microsoft Designer via Bing generiert.